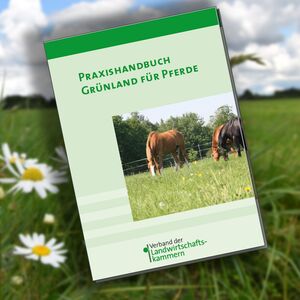Grünland aktuell
Das Grünlandteam der Landwirtschaftskammer SH
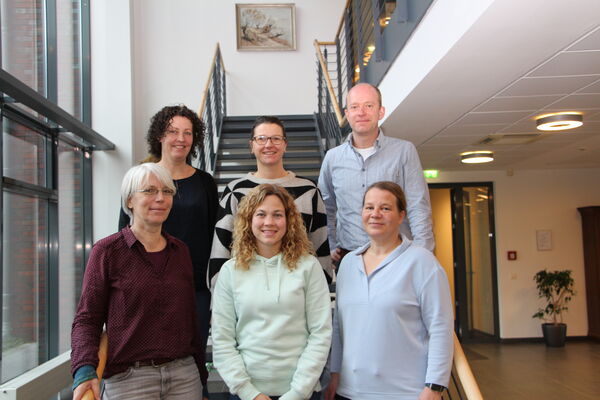
Wir sind für Sie / für Euch da!
v.li. nach re.: Liesel Grün, Janina Januschewski, Susanne Ohl,
hintere Reihe: Dr. Maria Hagemann, Julia Forderung und Christian Pahl.
Foto: Daniela Rixen, Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Broschüre zum Weidezaunbau
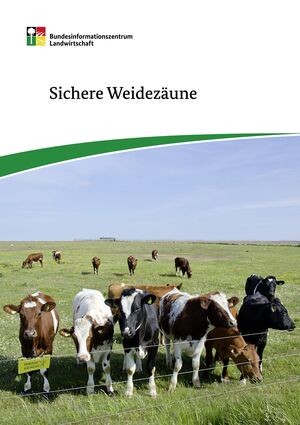
Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) hat eine kostenfreie Broschüre zum Thema Bau von Weidezäunen veröffentlicht. Darin finden sich Informationen zum Bau und Betrieb von Zäunen. Auch die Themen Schadensfall und Haftung werden in der Broschüre behandelt. Sie soll als Referenzwerk für den Bau und Betrieb von hütesicheren Zaunanlagen für Rinder, Schafe, Ziegen, im Gehege gehaltenem Wild, Schweine, Geflügel und Pferde dienen. Enthalten sind Fachinformationen zu den Grundlagen und Neuerungen des Zaunbaus und der Technik von Elektrozäunen. Darüber hinaus liefert die Broschüre Informationen zu wolfsabweisenden Zäunen bei den einzelnen Weidetierarten.
Neue Entscheidungshilfe zum Dauergrünlandumbruch
Bewirtschaftungsmaßnahmen, bei denen die Grünlandnarbe mechanisch zerstört wird, sind in bestimmten Gebieten verboten oder erfordern oft Anträge, die in der Regel beim Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL) zu stellen sind. Aufgrund verschiedener Gebietskulissen und Schutzgebiete sowie erforderlicher Stellungnahmen von fachkundigen Beratungsstellen kann diese Antragsstellung umfangreich und speziell sein. Der Entscheidungsbaum hilft dabei, sich einen Überblick über die Bestimmungen zu verschaffen, die auf den jeweiligen Dauergrünlandflächen gelten. Sind Eingriffe, die die Grünlandnarbe zerstören, möglich und sinnvoll, unterstützt der Entscheidungsbaum dabei, sich bei der Antragstellung für Genehmigungen oder Befreiungen zurechtzufinden. Darüber hinaus sind darin Informationen zum Glyphosateinsatz auf Dauergrünland enthalten.
Grundsätzlich sollte über ein angepasstes Management und eine regelmäßige Grünlandpflege vorbeugend gehandelt und nachhaltige Wege vorgezogen werden. Sind Reparaturen der Narbe nötig oder soll die Narbenzusammensetzung geändert werden, kann dies auch mit schonenden Maßnahmen erfolgen. Nur in Ausnahmefällen sollten Teilflächen der Dauergrünlandnarbe mechanisch zerstört werden, um Schäden zu reparieren.
Dann kann die Entscheidungshilfe zum Einsatz kommen. Sie wurde komplett überarbeitet und aktualisiert und ist auf der Homepage der Landwirtschaftskammer zu finden unter:
N-Bedarfsermittlung im Grünland
Hohe Stickstoffpreise: Verlustarme Gülledüngung und Nutzung von Leguminosen wichtig
Eine schriftliche Düngebedarfsermittlung bildet im Grünland- und Feldfutterbau den Grundstein für einen standortgerechten Nährstofffahrplan für die Düngesaison und muss vor der Düngungsmaßnahme vorhanden sein. Vor dem Hintergrund der aktuell hohen Preise für mineralischen Stickstoffdünger sollte die effiziente Ausbringung von organischen Düngern sowie die Etablierung von Leguminosen wie Klee besonders im Fokus stehen.
Nach der Düngeverordnung (DüV) muss vor dem Ausbringen von wesentlichen Nährstoffmengen (mindestens 30 kg P2O5/ha bzw. 50 kg N/ha) eine Düngebedarfsermittlung durchgeführt werden. Die schriftliche Berechnung des Bedarfes an Stickstoff (N) und Phosphor (P) muss je Schlag oder Bewirtschaftungseinheit bereits vor der ersten Düngegabe von mineralischen oder organischen Düngern dokumentiert werden. Der errechnete N-Düngebedarf ist als Obergrenze zu verstehen und darf nicht überschritten werden.
Ermittlung des Stickstoffdüngebedarfs
Außerhalb N-Kulisse
- N-Düngebedarf wird unter Berücksichtigung des mittleren Ertragsniveaus der zurückliegenden fünf Jahre ermittelt
- Ausgehend von diesem Durchschnittsertrag (dt TM/ha) und der daraus resultierenden N-Abfuhr wird Basis-N-Bedarf des Grünlands festgelegt (Übersicht 1).
- wenn das betriebsindividuelle Ertragsniveau der letzten fünf Jahre von den Basiswerten (Übersicht 1) abweicht, müssen Zu- und Abschläge in kg N/ha in Abhängigkeit des abweichenden Ertragsniveaus und des Rohproteingehalts berücksichtigt werden (Übersicht 2) (kann allerdings nur herangezogen werden, sofern im Betrieb repräsentative Rohproteinuntersuchungsergebnisse vorliegen)
Innerhalb N-Kulisse:
- innerhalb der N-Kulisse wird der Durchschnittsertrag aus den Jahren 2015 bis 2019 als feste Größe zu N-Düngebedarfsermittlung herangezogen
- Düngebedarfsermittlung erfolgt auch für Flächen innerhalb der N-Kulisse nach dem oben beschriebenen Verfahren
- der ermittelte N-Düngebedarf wird ist in einem weiteren Schritt insgesamt um 20 Prozent zu reduzieren
- Möglichkeit, N-Mengen innerhalb der Kulturen zu verschieben, sofern im Gesamtergebnis der verringerte gesamtbetriebliche Düngebedarf innerhalb der N-Kulisse nicht überschritten wird und auch auf der Einzelfläche die berechnete N-Obergrenze gemäß § 4 DüV eingehalten werden kann
Abzüge durch standortspezifische N-Nachlieferung
- N-Bedarfs wird zum Teil durch Standortnachlieferung aus mineralisierten N aus Bodenhumusvorrat gedeckt, welches von dem zuvor ermittelten N-Bedarf abgezogen werden muss
- Abschläge für die Stickstoffnachlieferung aus dem Bodenvorrat anhand von Tabellenwerten (siehe Übersicht 3); Humusgehalte in den Böden müssen somit grundsätzlich bekannt sein
- Weiterhin: N-Nachlieferung aus der organischen Düngung des Vorjahres muss in Höhe von 10 % der ausgebrachten N-Gesamtmenge von N-Düngebedarf abgezogen werden; anzusetzende Werte muss aus der Dokumentation der organischen Düngung aus 2021 entnommen werden
Leguminosen etablieren
- Leguminosen bilden Symbiose mit N-bindenden Bodenbakterien und können so zur Sicherstellung hoher XP-Erträge einen wichtigen Beitrag leisten (bis zu 400 kg N/ha können gebunden werden)
- Ertragsanteile der Leguminosen in den jeweiligen Bewirtschaftungseinheiten müssen geschätzt, und entsprechende Abschläge vorgenommen werden (Übersicht 4)
- wegen hoher Kosten für Eiweißkonzentrate oder mineralischer N-Dünger sollten die Vorteile der Leguminosen genutzt werden
- Beispiel Nachsaat Weißklee im Dauergrünland: Zum Zeitpunkt der geringen Konkurrenzkraft vorhandener Gräser; Nachsaaterfolge bei dauerhaft kurzer Grasnarbe unter Beweidung oder bei geringeren Zuwachsraten im Spätsommer am höchsten
- Klee-Nachsaat kann mit 1 – 2 kg Klee /ha im Gemenge mit Gräsern erfolgen
- pH-Wert nahe des bodenspezifischen Optimums ist entscheidend für erfolgreiche Klee-Etablierung
Wirtschaftsdünger effizient einsetzen
- es gelten generell die Werte für die Mindestwirksamkeit des Stickstoffs aus organischen oder organisch-mineralischen Düngemitteln im Jahr des Aufbringens organischer Dünger (Übersicht 5), mindestens jedoch der ermittelte Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff (NH4-N)
- übertrifft der Gehalt an verfügbarem Stickstoff oder Ammoniumstickstoff den angegebenen Wert der Mindestausnutzung im Jahr des Aufbringens, dann muss dieser für die N- Ausnutzung angesetzt werden (der jeweils höhere Wert gibt den Weg in der weiteren Berechnung vor)
- Beispiel: Liegt bei einer Rindergülle (3,5 kg Gesamt-N/m³, 2 kg NH4-N/m³) der NH4-N-Anteil oberhalb von der 50%-Mindestwirksamkeit (Übersicht 5), können nicht nur 1,75 kg N/m³ (50 % von 3,5 kg Gesamt-N) geltend gemacht werden, sondern müssen 2 kg NH4-N/m³ (57 % von 3,5 kg Gesamt-N) angerechnet werden, da dieser Anteil zu 100 % pflanzenverfügbar und mineralisch wirksam ist
- hohe mineralische Wirksamkeit der Gülle kann nur bei optimaler Witterung und effizienter Ausbringtechnik gewährleistet werden (Reduktion gasförmiger Verluste)
- bodennahe Ausbringtechnik ist dringend zu bevorzugen (nach DüV ab 2025 im Grünland verpflichtend!); N-Verluste sind in folgender Reihenfolge der Ausbringtechnik am geringsten: Injektion < Schleppschuh < Schleppschlauch < Breitverteilung
- Nährstoffzusammensetzung organischer Düngemittel muss generell auf Basis eigener Analysen oder anhand von Richtwerten nachzuweisen sein
- in N-Gebietskulissen müssen eigene Wirtschaftsdüngeranalysen vorliegen (nicht älter als ein Jahr alt!); für jede ausgebrachte Wirtschaftsdüngerart (z.B. Rindergülle, Gärsubstrat) muss eine separate Analyse vorliegen (Festmist von Huf- oder Klauentieren ausgenommen)
- Aufteilung der Gesamt-N-Menge sollte nach dem Pflanzenbedarf ausgerichtet werden; bei 4 Schnitten macht erste ertragsstarke Schnitt circa 40 % des Jahresertrags aus, sodass dementsprechend die N-Gabe hier höher ausfallen sollte als zu den nachfolgenden Schnitten
- Einzelgaben von circa 15–20 m³ Gülle pro Hektar sollten möglichst nicht wesentlich
überschritten werden; bei stark verdünnter Gülle sind allerdings auch
höhere Mengen möglich
Phosphordüngung
- P-Düngebedarf muss unter jeweiligen Standort- und Anbaubedingungen an zu erwartenden Erträge und Qualitäten unter Berücksichtigung der im Boden verfügbaren Phosphatmenge berechnet werden
- auf Flächen mit hoher P-Versorgungsstufe (P2O5-Versorgung >25 mg/100 g Boden (DL Methode)) dürfen phosphathaltige Düngemittel im Rahmen einer Fruchtfolge über drei Jahre höchstens bis in Höhe der voraussichtlichen Phosphatabfuhr aufgebracht werden
- aktuelle P-Bodenversorgung muss anhand repräsentativer Bodenproben, die für jeden Schlag ab einem Hektar Fläche, spätestens alle sechs Jahre erhoben und nachgewiesen werden
- Bodenversorgungsspezifische Beratungsempfehlungen finden sich in den Richtwerten für die Düngung 2021, herausgegeben von der Landwirtschaftskammer
Grundnährstoffe und pH-Wert bedenken
- um hohes Maß an Nährstoffeffizienz mit einer leistungsfähigen Grünlandnarbe zu realisieren, ist auch die Düngung der übrigen Grundnährstoffe Kalium (K), Magnesium (Mg) und Schwefel (S) näher zu fokussieren
- besonders sollte auch Augenmerk auf den standortspezifischen optimalen pH-Wert gelegt werden, um eine hohe Bodenfruchtbarkeit und Nährstoffnachlieferung zu gewährleisten und eine erfolgreiche Klee-Etablierung zu gewährleisten
- Wie immer gilt: Pflegemaßnahmen (Striegeln, Nachsaat, Walzen) sind in Abhängigkeit des Anteils an Qualitätsgräsern und der Lückigkeit des Bestandes anzuwenden
Planungstool der Landwirtschaftskammer
- optimale Versorgung der Grünlandbestände mit Nährstoffen lässt sich bequem über das neue Düngeplanungsprogramm der Landwirtschaftskammer auf Basis aktueller Bodenuntersuchungsergbnisse berechnen
- für Hilfestellung für rechtskonforme Bedarfsermittlung und optimale Grundnährstoffversorgung steht Düngeplanungsprogramm online zur Verfügung
unter https://www.lksh.de/landwirtschaft/duengung/duengebedarfsermittlung-duengeplanung-duengeplanungsprogramm/direkt-zum-duengeplanungsprogramm/ - weitere, ausführlichere Informationen finden Sie unter: https://www.lksh.de/landwirtschaft/duengung/neue-duengeverordnung-im-ueberblick/
- https://www.lksh.de/landwirtschaft/duengung/
Direkt zu den Übersichten N-Bedarfsermittlung Grünland
Dr. Anja Reinmers,
Dr. Lars Biernat,
Landwirtschaftskammer SH
Praxishandbuch: Grünland für Pferde
Neuer umfassender Leitfaden für Pferdegrünland
Das 90-seitige „Praxishandbuch Grünland für Pferde“ greift umfassend und praxisorientiert alle wichtigen Aspekte für die Bewirtschaftung von Pferdegrünland auf. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei gleichermaßen die hohen Ansprüche an Futtergrundlage und Auslauf, als Basis für die Gesunderhaltung und Leistungsfähigkeit des Pferdes.
In verständlicher Weise werden die komplexen Zusammenhänge zwischen den Standortgegebenheiten und dem praktizierten Weidemanagement sowie deren Einflüsse auf die Pflanzenbestandsentwicklung und Futterqualität behandelt. Weiterhin werden Themen wie Pflegemaßnahmen und Düngung eingehend erläutert. Viele praktische Hinweise untermauern die Einflüsse der Pflege und Düngung zur Entwicklung und Zusammensetzung des Pflanzenbestandes. Dabei stehen die Anforderungen des Pferdes an den Grünlandbestand stets im Vordergrund.
Zunehmend gewinnt die umweltfreundliche und nachhaltige Pferdehaltung und Grünlandbewirtschaftung an Bedeutung. So hebt ein eigenes Kapitel die Beweidung von artenreichen Grünlandbeständen mit Pferden als einen wesentlichen Beitrag für die Biodiversität hervor. Allerdings können unverträgliche und giftige Pflanzenarten, Weideparasiten oder auch eine sehr ungünstige Zusammensetzung der Futterinhaltsstoffe ernährungsphysiologische und gesundheitliche Risiken wie Hufrehe für Pferde bedingen. Das Handbuch zeigt diverse Risikobereiche auf und leitet daraus Handlungsempfehlungen der Risikovermeidung ab.
Das „Praxishandbuch Grünland für Pferde“ richtet sich nicht nur an interessierte Pferdehalterinnen und Pferdehalter, sondern auch an beratend Tätige, Berufs- und Fachschulen sowie landwirtschaftliche Lohnunternehmen. Es wurde in Zusammenarbeit der Landwirtschaftskammern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie der Universitäten Göttingen und Halle erstellt.
Das Handbuch erhalten Sie für 15 €. Ihre Bestellung richten Sie an pflanzenbau@lksh.de oder 0 43 31-94 53-342.
Liesel Grün
Landwirtschaftskammer